
[send
a postcard] |
Die
christlichen Gemeinschaften in Israel
Yishai
Eldar
Yishai Eldar ist der ehemalige Herausgeber von
Christliches Leben in Israel |
Quelle:
israel-mfa.gov.il
Die Geschichte der christlichen
Gemeinschaften im Lande Israel beginnt mit dem Leben und Wirken von Jesus
von Nazareth. Nach seinem Tod blieb die frühe apostolische Kirche –
wenigstens in und um Jerusalem – bis zum Wiederaufbau Jerusalems durch
Kaiser Hadrian als römische Stadt namens Aelia Capitolina (zirka 130
n.d.Z.) eine judenchristliche Gemeinde. Nach dieser Zeit setzte sich auch
die einheimische Kirche aus Heidenchristen zusammen. Ihre Einheit und
Einheitlichkeit blieb bis zu den frühen Ökumenischen Konzilien gewahrt.


Marienkirche
Oben: Der Garten Gethsemane |
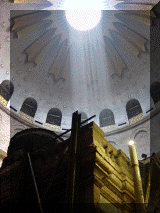
Grabeskirche, das Grab Jesu
Fotos: Lisa Bommel |
Zur Zeit der muslimischen Eroberung
(im 7. Jahrhundert) hatte sich die Kirche im Osten dann bereits in
verschiedene Richtungen aufgespalten, die jedoch anscheinend weiterhin die
heiligen Stätten gemeinsam nutzten. Erst mit der Errichtung des
Königreiches der Kreuzfahrer und der Vorherrschaft (praedominium) der
lateinischen Kirche des Westens kam es zum Konflikt über die heiligen
Stätten, der auch in der Zeit der Mamelucken und Osmanen nicht gelöst
werden konnte und bis zur Verkündigung des Status quo im Jahre 1852
andauerte.
Von den mehr als sechs Millionen
Menschen, die heute in Israel leben, sind 2,1% Christen (79,2% Juden;
14,9% Muslime; 1,6% Drusen; und 2,2% können keiner Religion zugeordnet
werden).
Die christlichen Gemeinschaften
lassen sich in vier Grundkategorien einteilen – chalcedonensisch-orthodoxe
Kirchen, nicht-chalcedonensisch orthodoxe Kirchen (Monophysiten),
römisch-katholische (Lateiner und Unierte) und protestantische Kirchen.
Diese Gemeinschaften setzen sich aus zirka 20 alten, einheimischen Kirchen
und weiteren 30, vorwiegend protestantischen Konfessionsgruppen zusammen.
Mit Ausnahme der Nationalkirchen wie der armenischen Kirche handelt es
sich bei den einheimischen Gemeinschaften im wesentlichen um
arabischsprachige Gemeinden; die meisten von ihnen sind
höchstwahrscheinlich Nachkommen der frühen christlichen Gemeinschaften aus
byzantinischer Zeit.

 |

Palmsonntag in der Grabeskirche
Armenische und griechisch-orthodoxe Mönche und Ministranten
Fotos: Lisa Bommel |
Die chalcedonensisch-orthodoxen
Kirchen
Die chalcedonensisch-orthodoxen
Kirchen (auch als orthodoxie des Ostens bezeichnet) bilden eine Familie
autonomer Kirchen, die den Lehrsätzen der sieben Ökumenischen Konzilien
folgen und den Ehrenprimat des Patriarchen von Konstantinopel anerkennen.
Historisch haben sich diese Kirchen aus den vier alten Patriarchaten des
Orients entwickelt: Alexandrien, Antiochien, Konstantinopel und Jerusalem.
Das griechisch-orthodoxe
Patriarchat von Jerusalem betrachtet sich als die "Mutterkirche" von
Jerusalem, deren Bischof die Patriarchenwürde durch das Konzil von
Chalcedon 451 erhielt. Zusammen mit den anderen Kirchen der Orthodoxie des
Ostens liegt es seit 1054 mit Rom im Schisma. Bei etlichen Aspekten dieses
Kirchenstreites handelte es sich um Fragen gegenseitiger Mißverständnisse,
und das historische Treffen zwischen Papst Paul VI. und dem Ökumenischen
Patriarchen von Konstantinopel Athenagoras im Jahre 1964 markierte den
Beginn eines Versöhnungsprozesses.
Zur Zeit der Eroberung Jerusalems
durch die Kreuzfahrer 1099 wurde das (orthodoxe) Patriarchat von
Jerusalem, das sich ohnehin bereits im Exil befand, nach Konstantinopel
verlegt. Eine ständige Residenz des griechisch-orthodoxen Patriarchen in
Jerusalem wurde erst 1845 wieder eingerichtet.
Seit 1662 lagen die
griechisch-orthodoxen Interessen im Heiligen Land bei der Bruderschaft des
Heiligen Grabes, die den Status der orthodoxen Kirche an den heiligen
Stätten zu sichern und den hellenistischen Charakter des Patriarchats zu
wahren versuchte. In den Gemeinden wird hauptsächlich Arabisch gesprochen.
Den Gemeindedienst versehen verheiratete arabische Priester sowie
Mitglieder der Bruderschaft des Heiligen Grabes.
Zwei andere historische
Nationalkirchen der Ost-Orthodoxie sind ebenfalls in Israel vertreten: die
russische und die rumänische Kirche. Infolge ihrer Kirchengemeinschaft mit
dem griechisch-orthodoxen Patriarchat unterstehen sie seiner lokalen
Jurisdiktion.
 |
Die russisch-
orthodoxe Kirche |
Die
russisch-orthodoxe Mission wurde 1858 in Jerusalem eingerichtet. Doch
russische Christen waren bereits im 11. Jahrhundert, nur wenige Jahre nach
der Christianisierung Kiews, zu Besuchen ins Heilige Land gekommen.
Derartige Besuche wurden in den folgenden 900 Jahren fortgesetzt. Sie
erreichten ihren Höhepunkt in den großen jährlichen Pilgerfahrten des
späten 19. Jahrhunderts, die bis zum Ersten Weltkrieg durchgeführt wurden
und mit der russischen Revolution ein Ende fanden. Seit 1949 liegt der
Anspruch auf den russischen Kirchenbesitz in den Territorien, die
inzwischen zum Staatsgebiet Israels gehörten, bei der russisch-orthodoxen
Mission (Patriarchat von Moskau); der Anspruch auf den Kirchenbesitz in
Gebieten, die damals unter jordanischer Verwaltung standen (1948-1967),
verblieb bei der russisch-ekklesiastischen Mission, die russisch-orthodoxe
Kirche im Exil vertritt. Beide Missionen werden jeweils von einem
Archimandriten angeführt, dem mehrere Mönche und Nonnen zur Seite stehen.
Eine Mission der
rumänisch-orthodoxen Kirche wurde 1935 eingerichtet. Sie wird von einem
Archimandriten geführt und besteht aus einer kleinen Gemeinschaft von
Mönchen und Nonnen in Jerusalem.
Die nichtchalcedonensischen
orthodoxen Kirchen
Die nicht-chalcedonensischen
orthodoxen Kirchen sind Kirchen des Ostens (Armenier, Kopten, Äthiopier
und Syrer), die seinerzeit die Lehrbeschlüsse des Konzils von Chalcedon im
Jahre 451 abgelehnt haben. Einer der Lehrsätze des Konzils betraf die
Relation der göttlichen Natur Jesu zu seiner menschlichen. Heute wird
jedoch sowohl in den chalcedonensischen als auch in den
nicht-chalcedonensischen Kirchen weitgehend anerkannt, daß die
christologischen Differenzen zwischen beiden Richtungen im Grunde nur eine
Frage der Formulierung und keineswegs ein Problem wesentlicher doktrinärer
Unterschiede war.
Die armenisch-orthodoxe Kirche
reicht bis in das Jahr 301 zurück, als die Armenier als erstes Volk das
Christentum annahmen. Seit dem 5. Jahrhundert gibt es eine armenische
Religionsgemeinschaft in Jerusalem. Armenische Quellen datieren das erste
Patriarchat nach einer Stiftungsurkunde des Kalifen Omar an den
Patriarchen Abraham in das Jahr 638. Das armenische Patriarchat von
Jerusalem wurde 1311 eingerichtet. Seit Ende des 19. Jahrhunderts,
insbesondere aber während des Ersten Weltkrieges und unmittelbar damach,
stieg die Mitgliederzahl der einheimischen Gemeinden an.
Die koptisch-orthodoxe Kirche hat
ihre Wurzeln in Ägypten, wo große Bevölkerungsteile während der ersten
Jahrhunderte n.d.Z. christlich wurden. Nach koptischer Tradition trafen
Mitglieder der Gemeinschaft zusammen mit Helena, der Mutter des römischen
Kaisers Konstantin, in Jerusalem ein (Anfang 4. Jahrhundert). Früh übte
diese Kirche Einfluß auf die Entwicklung des Mönchstums in der Judäischen
Wüste aus. Die Gemeinschaft prosperierte während der Mameluckenzeit
(1250-1517) und noch einmal unter Mohammed Ali im Jahre 1830. Seit dem 13.
Jahrhundert wird der (koptische) Patriarch von Alexandrien in Jerusalem
durch einen ortsansässigen Erzbischof repräsentiert.
Die äthiopisch-orthodoxe Kirche hat
spätestens seit dem Mittelalter, vielleicht sogar früher, eine Gemeinde in
Jerusalem. Historiker der frühen Kirche erwähnen bereits im 4. Jahrhundert
äthiopische Pilger im Heiligen Land. Sicher ist, daß die äthiopische
Kirche in den folgenden Jahrhunderten wichtige Rechte über die heiligen
Stätten besessen hatte, die sie nahezu vollständig unter der Herrschaft
der Osmanen – vor der Erklärung des Status quo – verlor.
Heute ist die äthiopisch-orthodoxe
Kirche in Israel eine kleine Gemeinschaft, die von einem Erzbischof
geleitet wird. Sie besteht im wesentlichen aus einigen Dutzend Mönchen und
Nonnen, die in der Altstadt von Jerusalem und im Kloster der äthiopischen
Kathedrale im Westteil der Stadt leben. Darüber hinaus existiert eine
kleine Laiengemeinschaft. Seit der Wiederaufnahme diplomatischer
Beziehungen zwischen Israel und Äthiopien im Jahre 1989 hat der Umfang
christlicher Pilgerschaft aus Äthiopien, insbesondere zu Weihnachten und
anläßlich der Feiern der heiligen Osterwoche, zugenommen.
Die syrisch-orthodoxe Kirche steht
in der Nachfolge der antiken Kirche von Antiochien. Sie ist damit eine der
ältesten christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten. Zu ihren Traditionen
gehört der kontinuierliche Gebrauch der alt-syrischen Sprache
(West-Aramäisch) in Liturgie und Gebet auch in der Gegenwart. Ihre
Mitglieder werden bisweilen als Jakobiten bezeichnet (nach Jakob Baradai,
der die Kirche im 6. Jahrhundert organisierte). Ihr Patriarch residiert in
Damaskus. Seit 793 – und permanent seit 1471 – gibt es syrisch-orthodoxe
Bischöfe in Jerusalem. Heute wird die einheimische Gemeinde von einem
Bischof geleitet, der in Jerusalem im St.-Markus-Kloster residiert.
Die römisch-katholischen und
unierten Kirchen
 |
Grabeskirche
|
Die römisch-katholischen und
unierten Kirchen sind Kirchen, die in ekklesiastischer Gemeinschaft mit
Rom stehen und den Primat und die geistliche Autorität des Papstes
anerkennen (der als Bischof von Rom das alte Patriarchat des Westens
verwaltet). In Fragen der Liturgie folgen die Ostkirchen in Gemeinschaft
mit Rom ihren eigenen Sprachen und Traditionen.
 |
Verkündigungskirche in Nazareth
|
Wie auch immer die frühen
Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel ausgesehen haben mögen, so gab
es doch bis zur Gründung des lateinischen Patriarchats von Jerusalem in
der Zeit des Königreichs der Kreuzfahrer (1099-1291) keinen Versuch, im
Heiligen Land eine westliche, vom orthodoxen Patriarchat unabhängige
Kirche zu errichten. Das Amt des lateinischen Patriarchen wurde dann 1847
erneut eingerichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt lag die Verantwortung für die
einheimische Kirche bei dem Franziskanerorden, der seit dem 14.
Jahrhundert Kustos der heiligen Stätten der Lateiner im Heiligen Land war.
Heute steht dem lateinischen
Patriarchat von Jerusalem ein Bischof vor, der den Titel eines Patriarchen
führt. Ihm stehen drei Vikare zur Seite, die in Nazareth, Amman und Zypern
residieren. Gemeinhin werden die einheimischen römischen Katholiken in
Anlehnung an ihre historische liturgische Sprache als "Lateiner"
bezeichnet. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil jedoch wird die
römisch-katholische Liturgie im allgemeinen in der jeweiligen
Landessprache zelebriert. Ausgenommen davon sind einige der heiligen
Stätten wie die Grabeskirche und die Geburtskirche, an denen die Messe und
andere Gottesdienste immer noch in Latein stattfinden.
1997 unterzeichneten Israel und der
Heilige Stuhl ein Abkommen, das die Gewährung des Status einer
juristischer Körperschaft an die Institutionen der katholischen Kirche in
Israel betrifft.
Die Kirche der Maroniten ist eine
christliche Gemeinschaft syrischen Ursprungs, deren Mitglieder heute
mehrheitlich im Libanon leben. Die Maroniten sind seit 1182 formal an die
römisch-katholische Kirche angegliedert. Es ist die einzige Ostkirche, die
völlig katholisch ist. Als eine unierte Körperschaft (eine an die
römisch-katholische Kirche angegliederte Ostkirche mit jeweils eigener
Sprache, eigenem Ritus und kanonischen Gesetzen) besitzt die Kirche der
Maroniten ihre eigene Liturgie, die dem Wesen nach ein antiochenischer
Ritus in alt-syrischer Sprache ist. Die meisten Mitglieder der
Maroniten-Kirche in Israel leben in Galiläa. Das maronitische
Patriarchalvikariat in Jerusalem wurde 1895 gegründet.
Die (melchitische)
griechisch-katholische Kirche entstand 1724 aus einem Schisma in der
griechisch-orthodoxen Kirche von Antiochien. (Der Begriff "Melchit" leitet
sich von dem griechischen Wort für "königlich" ab. Sein Gebrauch reicht
bis ins 4. Jahrhundert zurück, als mit ihm die einheimischen Christen
bezeichnet wurden, die die "Glaubenssätze" des Konzils von Chalcedon
angenommen hatten und somit dem kaiserlichen Sitz von Konstantinopel
verbunden geblieben waren.)
Eine griechisch-katholische
Erzdiözese wurde 1752 in Galiläa gegründet. Zwanzig Jahre später wurden
die griechischen Katholiken in Jerusalem dem melchitischen Patriarchen von
Antiochien unterstellt, der in Jerusalem durch einen Patriarchalvikar
vertreten wird.
Die syrisch-katholische Kirche,
eine unierte Absplitterung der syrisch-orthodoxen Kirche, ist seit 1663 an
Rom angegliedert. Die syrischen Katholiken haben ihren eigenen Patriarchen
(mit Sitz in Beirut). Seit 1890 ist ein Patriarchalvikar in Jerusalem als
geistlicher Betreuer für die kleine einheimische Gemeinde hier und in
Bethlehem zuständig. Im Juli 1985 konnte die Gemeinde ihre neue
Patriarchalkirche in Jerusalem dem heiligen Thomas, dem Apostel der Völker
in Syrien und Indien, weihen.
Die armenisch-katholische Kirche
trennte sich von der armenisch-orthodoxen Kirche im Jahre 1741, obwohl
bereits zuvor eine armenische Gemeinschaft in Cilicien (im Süden
Anatoliens) seit der Kreuzfahrerzeit mit Rom in Kontakt gestanden hatte.
Der armenisch-katholische Patriarch residiert in Beirut, weil die Behörden
des Osmanischen Reiches seine Residenz in Konstantinopel verboten hatten.
Ein Patriarchalvikariat wurde 1842 in Jerusalem eingerichtet. Trotz der
Union mit Rom unterhält die Kirche gute Beziehungen zur
armenisch-orthodoxen Kirche, und beide Kirchen arbeiten zum Wohl der
gesamten armenischen Gemeinschaft eng zusammen.
Die chaldäisch-katholische Kirche
ist als unierte Kirche die Nachfolgerin der alten (assyrischen)
Apostolischen Kirche des Ostens (manchmal auch Nestorianer genannt). Ihre
Mitglieder haben die alt-syrische Sprache (Ost-Aramäisch) in ihrer
Liturgie bewahrt. Die Kirche wurde 1551 gegründet. Ihr Patriarch residiert
in Bagdad. Die Gemeinschaft im Heiligen Land zählt nur wenige Familien.
Trotzdem besitzt die chaldäisch-katholische Kirche den Status einer
"anerkannten" religiösen Gemeinschaft in Israel. Seit 1903 werden die
Chaldäer in Jerusalem durch einen nicht ansässigen Patriarchalvikar
vertreten.
Die koptisch-katholische Kirche ist
seit 1741 mit Rom uniert. Doch erst 1955 ernannte der unierte
koptisch-katholische Patriarch von Alexandrien einen Patriarchalvikar zur
Betreuung der kleinen Gemeinde in Jerusalem.
Von größter Bedeutung für die
katholischen Kirchen im Heiligen Land war die Unterzeichnung eines
Grundlagenabkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Staat Israel
am 30. Dezember 1993. Das Abkommen führte zur Aufnahme voller
diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten einige Monate später.
Die protestantischen Kirchen
Die protestantischen Gemeinschaften
im Nahen Osten reichen nur ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Sie kamen im
Zuge der Gründung westlicher diplomatischer Vertretungen in Jerusalem ins
Land. Absicht der protestantischen Missionen war es, die muslimischen und
jüdischen Gemeinschaften im Land zu evangelisieren. Doch nur unter den
arabischsprachigen orthodoxen Christen waren sie erfolgreich.
Im Jahre 1841 beschlossen die
Königin von England und der König von Preußen die Gründung eines
gemeinsamen anglikanisch-lutherischen protestantischen Bistums in
Jerusalem. Zwar fand das Unternehmen 1886 ein Ende, doch das Amt wurde von
der Kirche von England zunächst beihalten, und 1957 setzte sie ihren
Vertreter in Jerusalem gar in den Rank eines Erzbischofs ein. Dieses Amt
wurde 1976 dann allerdings aufgehoben, als die neue (anglikanische)
Protestantische Episkopalkirche in Jerusalem und dem Nahen Osten
geschaffen und der erste arabische Bischof in Jerusalem gewählt und in
sein Amt eingeführt wurde. Es ist die größte protestantische Gemeinde im
Heiligen Land. Sitz des anglikanischen Bischof in Jerusalem ist die
Kathedrale des Märtyrers St. George, die von der Kirche von England durch
einen beauftragten Dekan unterhalten wird.
Mit Auflösung der gemeinsamen
englisch-preußischen Kirchenvertretung im Jahre 1886 hat die deutsche
lutherische Kirche eine unabhängige Vertretung in Jerusalem und dem
Heiligen Land gegründet. Diese Gemeinschaft hat eine zunehmende Zahl
arabischsprachiger Gemeindemitglieder angezogen, von denen viele ehemalige
Schüler der Schulen und Institutionen sind, die von der deutschen
lutherischen Kirche und ihren Gesellschaften getragen werden. Seit 1979
hat die arabischsprachige Gemeinde ihren eigenen Bischof und existiert
unabhängig von der kleinen deutschsprachigen Gemeinde und der lutherischen
Kirche in Deutschland, die von einem Propst repräsentiert wird. Beide
Gemeinden und ihre Geistlichen teilen die Räumlichkeiten der Propstei im
Muristan-Viertel der Jerusalemer Altstadt.
Darüber hinaus existieren Dänisch,
Schwedisch und Englisch sprechende lutherische Gemeinden mit Geistlichen
im Auftrag der Mutterkirchen zur Betreuung der Gemeindemitglieder, die
entweder besuchsweise in Israel oder hier ansässig sind. Die norwegische
Mission in Israel übergab 1982 die Amtsgewalt und Verwaltung ihrer beiden
Missionskirchen in Haifa und Jaffa in die Hände der einheimischen
Gemeinden.
Die Baptistenkirche nahm ihre
Arbeit im Heiligen Land 1911 mit der Gründung einer Gemeinde in Nazareth
auf. Heute hat der Verband der Baptistenkirchen insgesamt zehn Kirchen und
Zentren in Akko, Kana, Haifa, Jaffa, Jerusalem, Kfar-Yassif, Nazareth,
Petach Tikwa, Rama und Tur’an. Die Mehrheit der Gemeindemitglieder spricht
Arabisch.
Die (presbyterianische) Kirche von
Schottland entsandte ihre erste Mission im Jahre 1840 nach Galiläa. Sie
blieb in den folgenden 100 Jahren aktiv in den Bereichen der Erziehung und
medizinischen Versorgung der Bevölkerung tätig. Heute unterhält die
schottische Kirche als kleine, mehrheitlich im Exil lebende Gemeinde in
Jerusalem und Tiberias jeweils eine Kirche und ein Hospiz im Dienst der
Pilger und Besucher. Die unabhängige Edinburger Medizinische
Missionsgesellschaft betreibt ein Lehrhospital für Krankenschwestern in
Nazareth.
Die Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) gründete 1886 eine kleine Gemeinde in
Haifa und 1972 in Jerusalem. Zu den Mitgliedern der Kirche gehören heute
Studenten des Jerusalem-Zentrum für Nahoststudien, einer Zweigstelle der
Brigham Young University in Provo, Utah (USA).
Neben den bereits genannten Gruppen
gibt es eine lange Reihe sehr kleiner protestantischer Konfessionsgruppen
in Israel.
Drei protestantische kommunale
Landwirtschaftssiedlungen wurden in den letzten Jahrzehnten in
verschiedenen Regionen Israels ins Leben gerufen. Kfar Habaptistim,
nördlich von Petach Tikwa, wurde 1955 gegründet und bietet Konferenz- und
Ferienlagermöglichkeiten für Baptisten und andere protestantische
Gemeinschaften im Land. Nes Ammim, in der Nähe von Naharija, wurde von
einer Gruppe holländischer und deutscher Protestanten 1963 als
internationales Zentrum zur Förderung des christlichen Verständnisses
Israels ins Leben gerufen. Westlich von Jerusalem wurde 1971 Yad Hashmonah
gegründet, eine Institution, die als Gästehaus für christliche Besucher
und Pilger aus Finnland arbeitet.
Religionsfreiheit
Die grundsätzliche Haltung des
Staates gegenüber religiösem Pluralismus fand ihren Ausdruck in der
Unabhängigkeitserklärung Israels von 1948:
"Der Staat Israel ... wird auf den
Grundlagen von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Lichte der
Weissagungen der Propheten Israels gegründet sein; er wird volle soziale
und politische Gleichberechtigung aller Bürger ohne Unterschied der
Religion, der Rasse und des Geschlechts gewähren; er wird die Freiheit der
Religion, des Gewissens, der Sprache, der Erziehung und Kultur
garantieren."
Das Dokument bringt Vision und
Credo der Nation zum Ausdruck, und die Einhaltung dieser Grundsätze ist
gesetzlich garantiert. Jede religiöse Gemeinschaft hat die Freiheit, ihren
Glauben auszuüben, ihre eigenen Festtage und ihren wöchentlichen Ruhetag
zu begehen und ihre eigenen internen Angelegenheiten zu regeln
 |
Via Dolorosa |
Heilige Stätten
In Israel gibt es viele Stätten,
die den drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam)
heilig sind. Der freie Zugang zu diesen Stätten und das Recht, dort
Gottesdienste zu halten, wird gesetzlich garantiert.
"Die heiligen Stätten werden vor
Entweihung und jeder anderen Verletzung geschützt sowie vor allem, was den
freien Zugang der Mitglieder der verschiedenen Religionen zu den ihnen
heiligen Stätten oder ihre Gefühle in bezug auf diese Stätten verletzen
kann." (Gesetz
zum Schutz der heiligen Stätten, 1967).
Zu den heiligen Stätten, die für
die Christenheit von Bedeutung sind, gehören die Via Dolorosa, der Raum
des Letzten Abendmahls und die Grabeskirche in Jerusalem; die
Verkündigungskirche in Nazareth; und der Berg der Seligpreisungen, Tabgha
und Kapernaum am Kinneret-See (See Genezareth).
Das Ministerium für religiöse
Angelegenheiten
Das Ministerium für religiöse
Angelegenheiten trägt dafür Sorge, daß die rituellen Bedürfnisse aller
Religionsgemeinschaften erfüllt werden können. Es enthält sich jedoch
jeglicher Intervention in das religiöse Leben der christlichen Gemeinden.
Die für die christlichen Gemeinschaften zuständige Abteilung des
Ministeriums dient als Verbindungsbüro zu den staatlichen Stellen, an die
sich christliche Gemeinschaften mit Problemen und Anfragen wenden können,
die aus ihrem Status als Minderheiten im Land entstehen können. Das
Ministerium dient auch als neutraler Schiedsrichter zur Sicherung der
Einhaltung des erklärten Status quo an heiligen Stätten, an denen mehr als
eine christliche Gemeinschaft Rechte und Privilegien besitzt
"Anerkannte" Gemeinschaften
Bestimmte christliche
Denominationen besitzen den Status von "anerkannten" religiösen
Gemeinschaften. Aus historischen Gründen, die noch in die Zeit der
osmanischen Herrschaft zurückreichen, wird den geistlichen Gerichten
derartiger Gemeinschaften die Jurisdiktion in Personenstandsfragen wie
Eheschließungen und -scheidungen gewährt.
Zu den "anerkannten" christlichen
Gemeinschaften gehören die griechisch-orthodoxe Kirche, die armenische
Orthodoxie, die syrische Orthodoxie, die (lateinische) römisch-katholische
Kirche, die Maroniten, die (melchitische) griechisch-katholische Kirche,
die syrisch-katholische Kirche, die armenischen Katholiken, die
chaldäisch-katholische Kirche und seit 1970 die (anglikanische)
Episkopalkirche. |